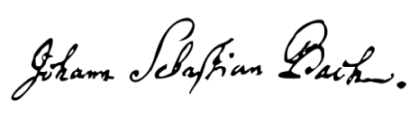Besprechung von 11.03.2002
|
|
|
Nur nicht mitreißen lassen
Renate Steiger trifft Maßnahmen, um Bach nicht falsch zu hören
Sie habe schon erlebt, schreibt Renate Steiger in ihrem
fünfundvierzig Jahre theologische Bach-Forschung summierenden
Werk, daß bei Aufführungen der "Matthäuspassion" die zuweilen als
lang empfundene Arie "Komm, süßes Kreuz" gestrichen wurde. "Hierzu
ist zu sagen, daß auch die Prediger des siebzehnten Jahrhunderts
schon wußten: Fleisch und Blut will nicht dran; es geht dem
Menschen schwer ein, wenn er leiden soll; er muß zum Kreuz - das
doch selten ausbleibt - gezwungen sein."
Die etwas kuriose
Rechtfertigung von Bachs Musik als Strafe verrät eine Haltung
lutherischer Orthodoxie. Und mit der Haltung befindet Steiger sich
auf Augenhöhe von Bachs Bewußtsein. So kann sie seinen
berühmten Bibeleintrag "Bey einer andächtigen Musique ist allezeit
Gott mit seiner Gnaden-Gegenwart" theologiegeschichtlich verorten.
Luther zufolge ist Christi Ankunft dreifältig: vergangenes Kommen
ins Fleisch, zukünftiges Kommen in Herrlichkeit und gegenwärtiges
Kommen in Gnade. Die Gnadengegenwart wiederum hat für die
lutherische Tradition ihren dreifachen Ort in Sakrament, Wort und
Musik: Altar, Kanzel, Orgel. Die Musik redet also nicht
von Vergangenem, Zukünftigem oder Jenseitigem, sondern Gott ist in
ihr oder durch sie in uns gegenwärtig. Und daraus könnte man dann
über Steiger hinaus das eigentümliche Verhältnis der Bachschen
Musik zur Zeit verstehen. Wer von Musik Entwicklungen, Höhepunkte
erwartet, dem müssen die Stücke mit ihren Wiederholungen,
Zergliederungen, Umstellungen, Farbveränderungen oft endlos
vorkommen. Aber die Endlosigkeit hat ihren präzisen theologischen
Grund in dem absoluten, zeitaufhebenden Charakter von
Sündenbewußtsein und Heilsgewißheit.
Jedem ist
selbstverständlich, daß zur Oper auch die Szene gehört. Den
musikalischen Ausdruck von Affekten und Charakteren verstehen wir
angemessen erst aus der Kenntnis des Handlungszusammenhanges.
Ebenso selbstverständlich müßte sein, daß zum Verständnis sakraler
Musik das Wissen um ihren liturgischen Ort und ihren theologischen
Sinn gehört. Musik ist keine angewandte Theologie, sie
interpretiert ihre Vorgaben. Aber diese Interpretation bekommen
wir als Interpretation gar nicht zu fassen, wenn wir, späte
Nachkommen der Schleiermacherschen Gefühlsreligion, davon
ausgehen, in der Musik spreche das Herz unmittelbar zum Herzen.
Gerade wenn wir die Musik nicht als religiöse Musik hören wollen,
müssen wir uns das Feld der theologischen Unterscheidungen
klarmachen, in dem sie Position bezieht. Steiger weist etwa darauf
hin, daß der leitende Affekt der evangelischen Passionsbetrachtung
nicht wie in der katholischen Devotion die compassio, das
Mitleiden, sei, sondern Schmerz und Reue über den Grund dieses
Leidens und freudige Dankbarkeit angesichts seiner Frucht. Damit
wird klar, warum Bach das italienisch Opernhafte nicht weniger
fremd ist als die pietistische Einfühlung. Wer sich von der
Dramatik der Bach'schen Musik mitreißen läßt, hört so falsch wie
der, der sich dem süßen Sehnen der Vorhalte ergibt: Er
unterschlägt den reflektierenden Selbstabstand, der Bach als
orthodoxem Lutheraner zweite Natur war.
Dennoch muß man zu
dem Buch gezwungen sein. Zwar verfährt es methodisch überaus
besonnen. Es geht nicht wie in der Musikwissenschaft üblich darauf
aus, einzelne musikalische Wendungen zu dechiffrieren oder Bachs
Symbolsprache zu rekonstruieren. Vielmehr wird vor dem Horizont
der zeitgenössischen Predigt- und Erbauungsliteratur der Textsinn
entfaltet und mit einer Gesamtdarstellung des musikalischen
Verlaufs in Beziehung gesetzt. Ziegler ist sehr bewußt, daß
musikalisch-rhetorische Figuren oder Ausdruckscharaktere ihre
bestimmte Bedeutung erst im Werkzusammenhang bekommen. Ja, sie
vergleicht, gestützt durch zwei beigefügte CDs,
Bachinterpretationen, weil ihr - musikwissenschaftlich fast eine
Sensation - klar ist, daß Musik erst als Vorgetragenes
Wirklichkeit hat und daß der Vortragende notwendig das eine oder
das andere hervorhebt. Aber sie bewegt sich in der Theologie der
Bachzeit wie ein Fisch im Wasser.
Wir können nur mit ihr
mitschwimmen und Kupferstiche, Emblemate, Predigten, geistliche
Lyrik an unserem Auge vorbeiziehen lassen, ohne wirklich zu einer
Karte des Teiches oder einem Verzeichnis seiner Bewohner zu
kommen. Vielleicht lernt man rückübertragend daraus, daß noch die
längste Bach-Arie nicht einfach nur lang ist, sondern eine
gerundete Architektur hat, über die hinreichend Auskunft zu geben,
Theologie nicht ausreicht.
GUSTAV FALKE
Renate
Steiger: "Gnadengegenwart". Johann Sebastian Bach im Kontext
lutherischer Orthodoxie und Frömmigkeit. Doctrina et Pietas,
Abteilung II, Varia, Band 2. Verlag Frommann-Holzboog, Stuttgart
2002. XXIII, 297 S., Abb., Notenbeispiele, 2 CDs, geb., 89,- .
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main